Ein Mann will nach oben
Zur Geschichte der Auswandererfamilie Guntern aus Reckingen
Quelle: Die mit einem Vorwort versehenen Briefe aus den Jahren 1897 bis 1914 wurden 1974 publiziert. (In: Wir Walser, 12. Jg., Nr. 2, S. 22-44.) Gemäss Dr. Albert Carlen, einem Verwandten der Migranten, wurden sie leicht redigiert.
Ein Überblick. Obwohl die Texte hin und wieder in einen Predigtstil münden, sind sie überaus informativ. Guntern, nach sechs Jahren Lateinschule in Brig gut gebildet, verfügte nicht nur über entsprechende Schreibkompetenz, sondern äusserte sich auch über soziale, politische und wirtschaftliche Belange. Entsprechend inhaltsreich sind zahlreiche Texte.
Die Familie übersiedelte erst kurz vor der Jahrhundertwende ins Gebiet der Auswanderer-Kolonien westlich von Santa Fe und übernahm dort bald Pachtland. Die Briefe liefern differenzierte Informationen über die Arbeits- und Lebensbedingungen. Das gängige Bild, dass sich Nachwanderer, die erst nach 1870 nach Argentinien kamen (als nahezu alles Land westlich von Santa Fe verteilt war), als Teilpächter, Knechte resp. Landarbeiter in die Abhängigkeit inzwischen wohlhabender Erstmigranten begeben mussten, wird von der Familie Guntern nicht bestätigt. Sie fand in San Jerónimo Norte (SJN) nicht nur Pachtland von beachtlicher Grösse, sondern konnte später zweimal in SJN, danach in Rafaela und später in Ceres auf immer grösseren Flächen wirtschaften. In Ceres bauten sie schliesslich auf 200 ha Weizen und Lein an und nutzten ebenso viel Land für die Viehwirtschaft.
Besonders wertvoll sind Gunterns ausführliche Schilderungen der Arbeitsabläufe und die detaillierten Auskünfte über die Beschaffungskosten für Nutztiere sowie für Maschinen und Saatgut. Ebenso über (potenzielle und reale) Erträge. Auch wenn Trockenheit und Heuschrecken in manchen Jahren die Ernte beeinträchtigten oder gar vernichteten, erreichte die Familie über die Jahre einen gewissen Wohlstand. Davon zeugen sowohl der grösser werdende Tierbestand als auch der Maschinenpark. Beleg ist auch, dass Julia Guntern 1910 für einen Verwandtenbesuch ins Wallis reiste. Ausserdem hätten sie um 1914 herum ohne eigenes Grundkapital kaum 450 Hektaren Land erwerben können. Auch wenn sie sich dabei mit 13'000 Pesos verschuldeten, konnten sie einiges an Eigenmitteln einsetzen.
Leider endet der Briefwechsel im Jahr 1914, so dass nicht bekannt ist, ob und wie erfolgreich die Familie und ihre Nachkommen in der Folge wirtschafteten. Da Argentinien während der Zeit des Ersten Weltkriegs den Export von Fleisch und Getreide markant steigern konnte, waren die Voraussetzungen für erfolgreiche Landwirtschaft jedenfalls gegeben.
Ein ganz gewöhnlicher Mensch bin ich nicht. Wie angemerkt, wirken manche von Gunterns religiöse Belehrungen aufgesetzt. Auch deswegen, weil er sie aus einer vermeintlich moralisch-ethischen Überlegenheit herleitete. Zu Selbstkritik war er wenig geneigt. Stattdessen äusserte er sich öfters negativ über Andersdenkende, besonders über sogenannte Freidenker. Grundsätzlich waren ihm alle Leute suspekt, in deren Verlautbarungen Gott keine Rolle spielte. Wenig einnehmend ist auch seine auf vermeintlich geistige Überlegenheit bauende Rechthaberei. Zum Beispiel in der Korrespondenz mit einem Neffen. Wegen einer Nebensächlichkeit wies er den 16-Jährigen in autoritärer Weise zurecht. Und er rechtfertigte seine Ausführungen explizit: Ich muss Dir frei und offen bekennen: ein so ganz gewöhnlicher Mensch, wie sie in der Welt sich tummeln und es einer dem andern nachmacht, bin ich nicht. Ich habe mich in Sachen von Belang nie nach andern gerichtet. Auch habe ich wenig danach gefragt, was die Leute von mir sagen. Später, nachdem die Eltern des jungen Mannes in einem Brief ausgeführt hatten, wie sehr ihr Sohn sich von ihm missverstanden fühle, entschuldigte er sich, allerdings nur halbherzig.
Wenn Guntern abwertend über seine Kritiker schrieb, tat er es vermutlich auch zum Selbstschutz. Man muss davon ausgehen, dass er mit seiner belehrenden Art viele vor den Kopf stiess. Einige bezeichnete er als Feinde. Das dürfte mit ein Grund gewesen sein, warum er mehrmals eine Pacht aufgab und andernorts wieder neu anfing. Die Wechsel, schreibt Carlen im Vorwort, habe der Ehefrau Julia missfallen, aber sie habe ihre Aufgabe darin gesehen, die Familie emotional zu versorgen. (Es ist anzunehmen, dass Guntern auch innerhalb der Familie autoritär war.) Er begründete die Ortswechsel mit der Notwendigkeit zur Expansion: Für eine so grosse Familie (mit schliesslich 12 Kindern) bräuchten sie mehr Fläche; sie könnten nicht mit Luft und Wasser und etwas wenigem leben. Der Drang nach Grösse (auch nach persönlicher Grösse) dürfte ähnlich stark mitgespielt haben.
Das Leben in Reckingen. Franz Guntern wurde am 8. November 1859 in Reckingen geboren. Seine Mutter war eine geborene Tenisch aus Binn. Franz hatte eine Schwester sowie einen zwei Jahre älteren und einen zwölf Jahre jüngeren Bruder. Beide wanderten nach Kalifornien aus. Die Schwester heiratete im Goms. Als 18-Jähriger trat Franz ins Kollegium in Brig ein, verliess die Schule aber nach sechs Jahren und kehrte aufs Bauerngut der Eltern zurück. In der Lateinschule soll er als Klassenbester geglänzt haben, aber ein anderes Studium als das der Theologie, zum Beispiel Medizin, war wegen der beschränkten Mittel der Familie nicht möglich. Mit 29 Jahren heiratete er Julia Müller aus Reckingen. Entwicklungsmöglichkeiten gab es für ihn, den ehrgeizigen jungen Mann, im Dorf kaum. Albert Carlen schreibt, die Reckinger Dorfmächtigen hätten ihn nicht aufkommen lassen; Ansehen habe nur genossen, wer einen grösseren Viehbestand besass. Guntern kompensierte das gesellschaftliche Defizit durch persönliche Weiterbildung. Sein besonderes Interesse galt der Medizin. Als er wegen gesundheitlicher Probleme eine sechswöchige Kneippkur machte, führte er darüber genau Buch. Er las sich auch intensiv in die Tiermedizin ein. Mit dem Resultat, dass er in Reckingen neben der bäuerlichen Arbeit als Viehdoktor tätig wurde. Damit nicht genug, schrieb er in der Folge ein Manuskript mit der Überschrift «Praktisches Rindvieh-Arzneibuch oder eine gründliche Anleitung, wie der Landmann die Krankheiten seines Rindviehes richtig erkennt und mit Erfolg heilen kann. Eine Spezialauflage für meine ökonomischen Verhältnisse und die meiner Generation. Von Franz Guntern-Müller, Reckingen (Wallis) 1893». Übers Entwurfsstadium kam das Werk nicht hinaus.
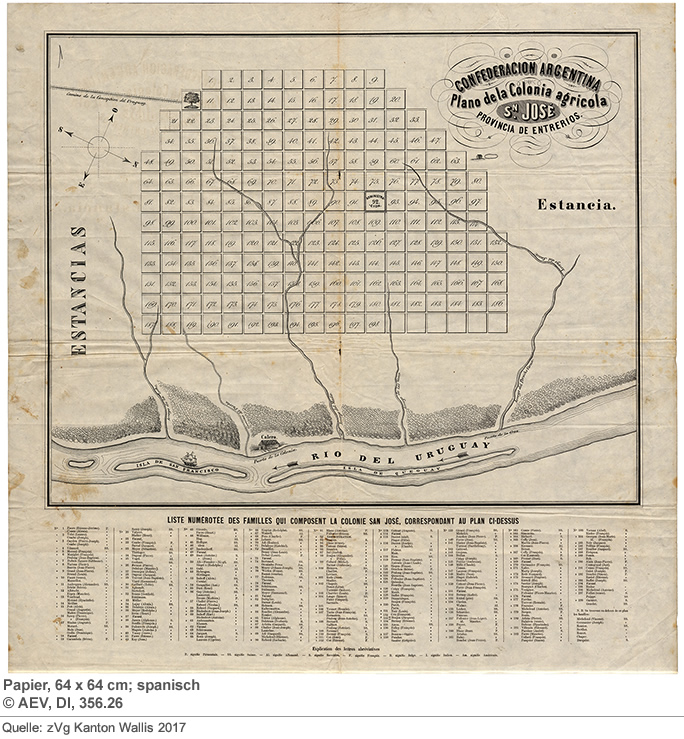

Das heute nicht mehr bediente Stationshaus.
Sieben Jahre nach der Heirat, das Ehepaar hatte inzwischen vier Kinder, entschloss sich Guntern zur Auswanderung. (Ob und wie stark seine Frau Julia die Entscheidung mittrug, weiss man nicht.) Bevor die Familie am 15. Januar 1896 von Reckingen Abschied nahm, liess Franz seinen und seiner Brüder Besitz an Wiesen, Äckern und Gebäuden versteigern. Viel Gewinn dürfte nicht herausgeschaut haben, mussten doch zuerst die von den Eltern hinterlassenen Schulden von 5'000 Franken beglichen werden.
Auf der winterlichen Schlittenfahrt von Reckingen nach Brig wurde die sechsköpfige Familie vom Vater der Ehefrau begleitet. Der Abschied von der Tochter soll diesen in einer Weise mitgenommen haben, dass er wenige Monate später starb. – In welchem Hafen die Familie Guntern einschiffte, ist nicht überliefert; jedenfalls ging die Reise via Buenos Aires nach Santa Fe und weiter in die Kolonie San Jerónimo Norte.
Die Briefe
Keine Mistschifere mehr auf dem Buckel
(Brief vom Juli 1897)
Der erste der noch vorhandenen Briefe trägt die Datumszeile San Geronimo. Julio 17 de 18971 und beginnt mit der Anrede Teuerste Schwester, lieber Schwager, liebe Brüder und Schwäger!2 Die Reise vom Wallis nach Argentinien wird im Text nicht thematisiert, was den Schluss zulässt, dass die Korrespondenz mit Reckingen viel früher begonnen hat. Der erste etwas längere Teil des Briefes stammt von Franz, der zweite ist von Julia verfasst. Guntern schreibt, im Glauben, dass Ihr Euch mehr freut, von ihr Briefe zu erhalten als von mir, habe er eigentlich Julia schreiben lassen wollen, aber weil ihr das Hausgeschäft viel zu schaffen mache, müssten sie sich mit seinen letras zufriedengeben. Das ist vermutlich mehr als blosse Floskel.
Was wird erzählt? Dass sie ein Jahr des Ruins hinter sich hätten, aber für die nahe Zukunft zuversichtlich seien. Auch weil sie offenbar kurz davorstehen, eine Pacht zu übernehmen. Mit dem Geld, das sie aus dem Wallis überwiesen bekommen hätten, schreibt Franz Guntern (FG), werde er einige Kühe, Pferde und, soweit es reicht, notwendige Instrumente und Fahrnisse kaufen.3 Zudem informiert er über Meteorlogisches, zum Beispiel, dass sie im vergangenen Sommer glühende Sonnenhitze von 40-42° Celsius hätten überstehen müssen – daran würden sie sich wohl rasch gewöhnen –, gegenwärtig (Wintermonate auf der Südhalbkugel) sei es tagsüber angenehm frisch und nachts nicht kälter als minus 4 Grad. Im vergangenen Winter habe es kaum Fröste gegeben. Jedenfalls könne man während dieser Zeit die schönsten Gartengewächse und Gemüse ernten.
Das freudigste Ereignis liegt gut drei Wochen zurück: Am 22. Juni habe Julia das fünfte Kind zur Welt gebracht, Marie, ein schönes Mädchen. Als ob er sich rechtfertigen müsste, fügt er hinzu, es komme in Amerika nicht so darauf an, im Gegenteil, eine Familie mit vielen Kindern komme hier eher auf einen grünen Zweig als eine mit wenigen.
Im von Julia geschriebenen Teil liegt der Fokus auf dem Empathischen, erzählt sie doch davon, wie oft ihre Gedanken bei ihnen, den Unvergesslichen allen, seien und wie wichtig ihr die Korrespondenz mit den Angehörigen sei. Hauptsächlich sehne sie sich aber danach, einmal mit Euch mündlich sprechen zu können. Franz sagt mir, wenn es uns gut gehe, könne ich in 15 Jahren einmal nach Hause kommen. Das verrät einiges über ihre emotionale Befindlichkeit, bedeutet jedoch kaum, dass sie ins Wallis zurückkehren möchte. Sie schreibt nämlich auch: Die Holzgabele und die Misttschifere4 habe ich nicht auf dem Buckel und habe auch kein Heimweh danach. Zu den heimatlichen Arbeitsverhältnissen zurückzukehren, ist für sie keine Option.
Wo zehn Kinder sind, wartet Arbeit für Mutter und Vater (Brief vom April 1904)
(Die Briefe zwischen 1897 und 1904 dürften verloren gegangen sein.)
Im April 1904 befinden sich die Gunterns nach wie vor in SJN, auf Pachtland elf Kilometer vom Dorfzentrum, der Plaza, entfernt. Zentrales Thema ist die Arbeitsbelastung. Ich habe so ungemein viel Arbeit, auch Sonntags, wenn man in die Messe fährt. (…) Ihr werdet begreifen, dass, wo zehn Kinder sind, Arbeit wartet für Vater und Mutter. Für den Weg zur Kirche und wieder zurück bräuchten sie mit dem Pferdegespann zwei Stunden. Als der Brief des Schwagers eingetroffen sei, habe er bei der Dreschmaschine gearbeitet und antworte darum erst jetzt. Ob er beim Dreschen der eigenen Ernte mithalf oder darüber hinaus Lohnarbeit leistete, erklärt er nicht. Sicher ist, dass sie schon während längerem Pächter sind. Endlich hätten sie ein gutes Jahr gehabt – mit einem Ertrag von 217 Kilozentner Weizen und 25 Kilozentner Leinsamen.5 Der Verkaufserlös betrage umgerechnet gut 2'300 Franken. Ein ausgeglichenes Budget resultiere daraus jedoch nicht, da die bisherigen Ausgaben die Einnahmen noch immer überstiegen. Die notwendigen Geräte, eine Egge, ein Zweischarpflug sowie eine Kleeschneidemaschine, hätten viel gekostet. Allein für die Schneidemaschine habe er 125 Pesos ausgeben müssen. Dazu kamen Ausgaben für Zugtiere. Gegenwärtig besitzen sie zehn Pferde. So viele brauchen sie allein, um mit dem grossen Pflug einen ganzen Tag (mit Pferdewechsel) zu fahren. Auch der Egge müssen vier Pferde vorgespannt werden.
Inzwischen hat das Ehepaar zehn Kinder, was auch heisst, dass Julia Guntern regelmässig schwanger ist. (Es werden zwei weitere Geburten folgen.) Mit der Kleinkinderschar ist ihre Arbeitsbelastung nicht kleiner als die des Ehemannes. Was die älteren Kinder betrifft, so können auch sie dem Vater noch nicht viel Arbeit abnehmen; Franz, der Älteste, ist 1904 noch nicht mal 15-jährig. Wie die folgende Briefpassage zeigt, setzt FG trotzdem auf weiteres Wachstum:
(…) Ich habe jedoch bloss einen kleinen Anfang gemacht und muss die Sache noch grösser betreiben; denn der Landarbeiter, der auf einen grünen Zweig gelangen will, muss hier, zumal als Lehensmann, den Ackerbau im grossen betreiben. Und eben dazu braucht es ein ordentliches Kapital. Um drei Concesiones, das sind 102 Hektaren, anzupflanzen, braucht es 23 Pferde, 2 grosse Pflüge, zwei Eggen und einen kleinen, einscharigen Pflug. Dieser macht je eine Furche, der grosse zwei Furchen zugleich. Dann hat man zwei Wagen mit hohem Bretteraufsatz nötig, um den geschnittenen Weizen auf den Schochen oder Haufen zu führen, sowie eine Schneidemaschine, an die man sechs Pferde anspannt. Ich hoffe es auf diese Weise in ein paar Jahren einzurichten, wenn es Gottes Wille ist. Und dann, wenn wir das alles haben und wenn alles bezahlt ist, dann geht's mit Gottes Hilfe drauf los. So und nur so gelangt hier der arme Lehensmann zu einem ordentlichen Heim. Wenn hier in Argentina weitere 8 Jahre verflossen sein werden und Gott unsere Arbeit segne, dann glaube ich, werden wir etwas besitzen. (…)
Auch wenn er (noch) Lehensmann ist, erkennt man, dass Guntern mittelfristig den Pächterstatus überwinden möchte. Auf einen grünen Zweig gelangen kann bedeuten, mit genügend Pferden und Maschinen schuldenfrei zu wirtschaften. Wenn er aber schreibt, erst dann gehe es drauf los, so dass sie nach acht Jahren etwas besitzen würden, lässt sich das als Wunsch nach Grundbesitz lesen. Er, der damals des fehlenden Geldes wegen nicht studieren konnte, strebt acht Jahre nach der Emigration energisch den sozialen Aufstieg an.
Euer neues Hotel gefällt uns sehr gut(Brief vom 9. August 1905)
Die Fakten in Kürze: Seit Februar wirtschaftet die Familie Guntern auf einer neuen Pacht, nur noch 45 Minuten von der Plaza entfernt. Ein weiteres Kind, Sohn Pablo, wurde geboren. Die Ackerfläche wurde auf 60 Hektaren erweitert (Weizen: 34 ha; Lein: 24 ha; Gerste: 2 ha). Um für die nunmehr 14 Pferde genügend nährstoffreiches Futter zu haben, baut er auf eine Fläche von 10 ha Luzerne an.6 Auch die Bestände an Rindern, Schweinen und Hühnern sind gewachsen. Guntern ist daran, mit Nutztieren einen zusätzlichen Erwerbszweig aufzubauen. Weil es an Futter mangle, sei das Vieh zurzeit mager. – Ein Lichtblick ist, dass er die Buben im Felde einsetzen kann.
Ein Satz sticht hervor: Die Ansicht Eures neuen Hotels gefällt uns sehr gut; nur möchte ich einmal fragen: Haben sie da um das Haus herum Bäume gepflanzt, oder wie stellt sich die Sache vor? Weil der Kontext fehlt, bliebe die Passage rätselhaft, wenn nicht Albert Carlen in der Fussnote Erklärungen liefern würde. Tatsächlich hätten Eugen Müller, Julia Gunterns Bruder, und seine Frau in Reckingen das Hotel Blinnenhorn bauen lassen. Wer heute durch das Gommer Dorf fährt, kommt an einem Hotel mit diesem Namen vorbei. Es ist jedoch mit der ehemaligen Baute nicht identisch, steht aber vermutlich an der gleichen Stelle.

Das im Brief genannte Hotel wurde später als Kaserne für Armeeoffiziere genutzt. (Reckingen ist ein Ausbildungsplatz für die Fliegerabwehrtruppen.) Zahlreiche Gebäude und ebendiese Unterkunft wurden im Winter 1970 zum Schauplatz einer Katastrophe. Die Bächitallawine brachte am frühen Morgen des 24. Februar Tod und Verderben über das Dorf. Die Lawine fegte auch das ehemalige Hotel Blinnenhorn hinweg. Verschüttet wurden 48 Menschen, von denen nur 19 lebend geborgen werden konnten. Unter den 30 Toten waren 19 Offiziere.


Wenn ich auch praktisch nicht fähig bin, … (Brief vom 30. April 1906)
Schon neun Monate später trifft der nächste Brief aus SJN in Reckingen ein. Wiederum mit der Ankündigung, aufs kommende Jahr werde man die Pacht wechseln. Wenn eine Nachbarin von ihrer Reise ins Wallis zurückkomme, werde man nur noch für kurze Zeit in ihrer Nähe sein. Wir haben nämlich für's Jahr 1907 schon ein anderes Land gepachtet. Wir ziehen nach Rafaela (Belitalia), ca. 15 Stunden weiter landeinwärts. Wir haben dort ein grösseres Land, welches uns auch mehr einbringen soll. Dort, glaubt oder hofft FG, würden sie jährlich 1000 Pesos auf die Seite legen können. Im vergangenen Jahr habe er mit 1600 Pesos Einkommen gerechnet, eingenommen hätten sie jedoch nur 800.
Er nennt einmal mehr die hohen Kosten, insbesondere für den Kauf weiterer Zugtiere und Geräte. Inzwischen besitzen sie 24 Pferde sowie unter anderem je zwei Doppelpflüge und Eggen. Guntern investiert so viel wie möglich; er ist überzeugt, dass nur die Erweiterung der Anbaufläche sie voranbringt. Ziel ist es, nicht nur schuldenfrei zu werden, sondern Geld auf die Seite legen zu können. (Nach einem Jahrzehnt in Argentinien dürfte er das ökonomische Potenzial realistisch einschätzen.) Zweifellos baut er auch auf die zunehmende Leistungsfähigkeit der Kinder. – Auf die Erzählung, wie sehr im Jahr zuvor Wetter und Heuschrecken die Erträge beeinträchtigt hätten, folgt eines der angesprochenen religiösen Statements, das hier als Beispiel zitiert sei:
(…) Doch warum klagen? Mitunter geht's noch viel schlechter. Wenn alles immer den regelmässigen Gang geht, dann werden die Menschen hochmütig. Sie glauben, von niemand mehr abhängig zu sein, und in ihrer Geisteshoffahrt bauen sie sich ihr zukünftiges Verderben. Sie vergessen Gott, leugnen ihn, spotten seiner Gerichte und beschwören so ihren ewigen Untergang herauf. So töricht wollen wir nicht sein, mag kommen, was da will. Nur der Tor spricht in seinem Herzen: Es gibt keinen Gott. Ein wahrer Christ aber hat die Überzeugung, dass es einen Gott gibt, und hoffet auf ihn. In te Domine speravi, non confundar. (…)
Der lateinische Schlusssatz lässt nicht nur tief blicken, sondern zeigt auch, wie Gunterns Urteile über die Hochmütigen zu verstehen sind. Gott direkt ansprechend, reklamiert er eine Gegenleistung für seinen unerschütterlichen Glauben – einem Lohnarbeiter ähnlich, der Bezahlung fordert. Sinngemäss übersetzt und leicht zugespitzt, sagt er: ‘Gott, Du wirst mein bisheriges Vertrauen in dich nicht beschämen wollen, indem du mich erfolglos bleiben lässt!’ Während die Gottesleugner seiner Ansicht nach ihr Verderben selbst verschulden, meint er Glaubensstärke gerade dadurch zu beweisen, dass Misserfolge bei ihm nicht in Wehklagen münden. Derart diszipliniert zu sein, muss seinem Glauben gemäss schliesslich belohnt werden. Das Gunternsche Glaubensmodell ähnelt einer Versicherung mit Selbstbehalt. Der Versicherte übernimmt einen kleinen Teil der Kosten, aber den grossen Rest trägt die Versicherung. Auf den Landmann angewendet, Heuschrecken- oder wetterbedinge Verluste erträgt er klaglos, aber bezüglich eines mittel- und langfristigen Erfolgs soll sich der wahre Christ auf Gott verlassen können. Eine bemerkenswerte Kosten-Nutzen-Rechnung!
Am Ende des Briefes macht der Schreiber dem Ärger Luft über eine Walliser Schwägerin, die einen nach Argentinien adressierten Brief retourniert bekommen und daraus geschlossen hat, die Guntern würden die Briefe auf der Post nicht abholen. Das nervt ihn; er habe ja darauf aufmerksam gemacht, wie die korrekte Anschrift laute. Sie wollten es halt drüben besser verstehen als er hier. Für ihn ist das Ganze eine Frage mangelnder Intelligenz. Was er mit einer Selbstdefinition pointiert: Wenn ich auch praktisch nicht so fähig bin, so bin ich doch theoretisch schon manchem voraus gewesen. Da die Walliser Verwandten keinerlei Anlass haben, an Gunterns praktischen Fähigkeiten zu zweifeln, bekommen sie nun mitgeteilt, wie sie erst sein geistiges Potenzial einzustufen haben.
In einer kurzen Nachschrift äussert sich auch Julia Guntern: Sie übermittelt Grüsse und bittet um ein kleines Andenken.
Mit Pferdestärken bewegte oder mit Dampfkraft angetriebene Maschinen
(Briefe vom 8. und 14. März 1909 aus Rafaela)
Drei Jahre später verfasst Guntern wiederum einen Brief an einen Schwager. Es sind an sich zwei innerhalb weniger Tage entstandene Texte, beide auf die Rückseite einer grossen Eisenbahnkarte der Republik Argentinien geschrieben. Und zwar als Antworten auf die Walliser Bitte um eine Landkarte Argentiniens. Das wird Anlass für eine Fülle von Informationen, einerseits was Grösse, Gliederung und Einwohnerzahl betrifft, andererseits über die Art und Weise, wie in der Provinz Santa Fe Landwirtschaft betrieben wird. Das ist für uns heute besonders informativ, erfährt man doch sonst aus Migrantenbriefen selten etwas, das über Lokales hinausgeht.
Was Demografisches betrifft, informiert FG, dass Argentinien sechs Millionen Einwohner habe, von denen mehr als eine Million in Buenos Aires lebten. Er hält allerdings fest, dass eine genaue Volkszählung schwierig zu machen wäre. Die Provinz Santa Fe, so Guntern, umfasse eine Fläche von 128'684 Quadratkilometern (eine Grösse, die im Vergleich zu heutiger Angabe um 4'500 Quadratkilometer zu tief ist). Das entspricht 4,8 Prozent der Landes-Gesamtfläche von 2.780.400 Quadratkilometern. (Die Schweiz hätte auf Argentiniens Territorium 67mal Platz.)
Besonders interessant sind die Ausführungen über die Grossflächen-Landwirtschaft in der Provinz Santa Fe. Wir erfahren, dass die meisten der zum Einsatz kommenden Maschinen aus den USA importiert werden. (Die beigelegten Bilder sind leider nicht mehr vorhanden.) An Vieh gebe es eine kolossale Masse, darunter eine Menge Rassetiere aus europäischer Zucht. Auch Schweizer Vieh – Freiburger und Simmentaler.
(...) Hier in Rafaela wird dieses Jahr eine neue Kirche gebaut. Man hat zu diesem Zwecke schon 80000 Pesos gesammelt. Der Pfarrer ist ein Spagnol, ein sehr eifriger Priester. Die Männerwelt des Städtchens hat wenig Religion. Rafaela ist im Aufschwung und hat vier Bahnstationen. Die Landpreise sind in den verflossenen zehn Jahren um das Doppelte gestiegen, so dass es für Zuzüger nicht mehr so leicht ist, Land zu erwerben. Vor zehn Jahren bezahlte man die Hektare 50-60 Pesos oder Thaler; heute kostet sie 100 bis 150 und selbst 200 Pesos. Ich denke daher nicht an Landkauf; denn ein kleines Land – 60 bis 100 Hektare muss man hier für eine grössere Familie ein kleines Land nennen – ein kleines Land wäre nur ein Hemmschuh, um hier voranzukommen. Für eine grosse Familie ist es besser, im grössern Massstabe zu pachten. Man ist dann überhaupt nicht an die Scholle gebunden. Wenn es auf einem Lande nicht mehr rentabel ist zu pflanzen, so kann man sich ein ertragreicheres suchen; denn frisch aufgebrochener Boden wirft zuweilen die doppelte Ernte eines schon lange bebauten Ackers von gleicher Dimension ab. (...)
Leider ist der Ackerbau an viele Kosten gebunden. Z. B. wir werfen im Werte von 500-600 Pesos Samen aus und arbeiten 2-2½ Monate, die Sonn- und Festtage ausgenommen, täglich mit 20 Pferden, mit 10 am Vormittag und 10 am Nachmittag. Auf beiliegendem Blatt könnt Ihr Euch die Maschine anschauen, mit welcher man den Weizen und den Lein schneidet. Die Maschine wird mit 6 Pferden bespannt, der Wagen, der im gleichen Schritte neben der Maschine fährt und der das geschnittene Getreide aufnimmt, mit 4 Pferden. Solche Wagen braucht es zwei oder drei. Wenn ein Wagen beladen ist, fährt er zum Getreidehaufen oder Schochen und ein anderer fährt neben die Maschine vor. Während ein Wagen beladen wird, wird der andere abgeladen, sodass die Schneidemaschine kaum zum Stillstand kommt ausser zum Schmieren. Das Abladen und beim Dreschen das Aufgabeln sind hier die schwersten Arbeiten, denen mancher neu angekommene Europäer nicht gewachsen ist. Die Hitze und die pausenlose, fortwährende Anstrengung, das ist es eben, was die Kräfte erschöpft. Die Arbeiter werden heute bei dieser Arbeit gut bezahlt, täglich 5-8 Pesos. Beim Schneiden müssen 6 Mann dabei sein.
Nach ein bis zwei Monaten kommen die Dreschmaschinen und fahren von einem Kolonisten zum andern. Sie fahren mit Dampfkraft und dreschen auch so, und zwar schnell, 200 bis 500 Zentner im Tag. Sie lassen sich aber auch gut bezahlen, nämlich 1.20-1.50 Pesos per 100 Kilo. Nebenbei braucht man noch die Säcke. So könnt Ihr Euch, glaube ich, einen Begriff machen, was ein Ackerbauer hier für Auslagen hat.
Man geht darum sicherer voran, wenn man dazu auch Viehzucht und Milchwirtschaft betreiben kann, weil der Ertrag Weniger [!] gefährdet ist und die Kosten viel geringer sind. Wir fahren gegenwärtig täglich 200 Liter Milch zur Entrahmungsfabrik. Das haben wir sicher; die Ernte aber schwebt immer in Gefahr, bis sie endlich im Sacke ist. Deswegen kann ein Ackerbauer leicht Schulden machen und sich bei Fehlernten sogar ruinieren. (...)
Erstaunen löst die Behauptung aus, 100 Hektaren seien für seine Familie eine zu kleine Fläche. In den 1860er-Jahren erhielten die ersten Migranten-Familien in SJN je 33 ha Fläche (eine Konzession) zugeteilt. Die besonders erfolgreichen Kolonisten erwarben später eine oder zwei weitere Konzessionen hinzu und hatten damit in der Folge eine hinreichende Lebensgrundlage. Nicht wenige gelangten zu beachtlichem Wohlstand. Auch solche mit vielen Kindern.
Was die Beschreibung der Erntearbeit betrifft: Der Hauptunterschied zwischen damals und jetzt besteht darin, dass heute gleichzeitig geerntet und gedroschen wird. Schnitt und Abtransport dagegen erfolgten ähnlich: Neben der Mähmaschine bzw. dem Mähdrescher fährt ein Wagen mit, der das Schnittgut resp. das Korn aufnimmt. Ist dieser voll, löst ihn der nächste ab. (Das zurückbleibende Stroh wird später vom Feld geholt.) Dass damals insgesamt zehn Pferde vorgespannt wurden, wirkt dagegen spektakulär. Im Postscriptum berichtet Guntern, dass hinten auf dem Ruder des Sechsspänners der 18-jährige Franz Pferde und Maschine führe, die 3,7 m breit schneide, während Otto, der Zweitälteste, mit dem Vierergespann das Getreide aufnehme (das im Übrigen maschinell aufgeladen wird). Ein Knecht folge mit dem leeren Wagen, um sofort neben die Maschine vorzurücken, wenn der andere Wagen voll beladen ist.
Heute braucht’s bei der Ernte keine Pferde mehr. Auch aufgabeln und abladen später beim Dreschen entfallen, bläst der moderne Mähdrescher das ausgetriebene Korn doch direkt in den mitgeführten Wagen, worauf dieser zu einer Sammelstelle gefahren und hydraulisch entleert wird. Heutige Getreideernten sind weniger schweisstreibend, und mehr als drei oder vier Personen werden auf dem Feld nicht benötigt. Guntern dagegen muss für die Ernte mehrere Knechte beschäftigen.

Was den Vergleich der Kapazität damaliger und heutiger Dreschmaschinen betrifft, so ist ein moderner Mähdrescher zweifellos leistungsfähiger, einen Quantensprung von damals zu heute gab es jedoch nicht.
Im Nachtrag kommt der Schreiber aufs Ackern und Einsäen zurück. Auch hier war die Mechanisierung weit fortgeschritten: Sie könnten mit zwei Fünfer-Gespannen täglich vier Hektaren pflügen. Mitte Mai beginne die Aussaat, ebenfalls mit einer Maschine:
Sie ist 3.70 m lang. In den langen Kasten schüttet man einen Sack von 60-70 Kilo Weizen oder Lein, spannt zwei Pferde davor, setzt sich auf den Kasten und fährt den zu säenden Acker ab. So sät man per Tag 10-12 Säcke oder 10-12 Hektaren. Die Eggen folgen hinten nach, je mit vier Pferden bespannt. Zur gleichen Zeit wird auch gewalzt.
Den Walliser Verwandten dürften Beschreibungen wie diese vorgekommen sein, als ob sie aus einer anderen Welt stammten (was ja im Grunde genommen auch so war). Nicht nur der Mechanisierung wegen; den Gommer Bauern gehörten ein paar wenige Hektaren Land; die Äcker, auf denen sie zur Selbstversorgung Roggen und Kartoffeln anbauten, waren selten grösser als fünf Aren. Zudem erfolgte vom Umbrechen des Bodens übers Anpflanzen bis zum Ernten alles in Handarbeit. Noch bis in die 1950er-Jahre gab es hier (in der Schweiz überhaupt) keine auch nur annähernd vergleichbare Mechanisierung. Von Grengiols, einer anderen Gommer Gemeinde, ist bekannt, dass es da im Jahr 1960 noch 80 Bauern gab, aber nur drei landwirtschaftliche Maschinen. Nahezu alles wurde wie vor Jahrhunderten gemacht. (Grengiols ist eines der grössten Oberwalliser Bauerndörfer; mehr als ein Dutzend Landwirte gibt es heute da nicht mehr.)
Am Ende des Briefes macht FG nochmals auf die Risiken des Ackerbaus aufmerksam. Darum verfügt er inzwischen mit der Viehhaltung und entsprechendem Milchertrag über ein zweites ökonomisches Standbein. Der Hinweis auf die Rahmfabrik belegt zudem den Stand der Verarbeitung bäuerlicher Produkte. Für einen Liter Milch, erfährt man später, bekämen sie nur 3 Cts. In einem der Briefe vom Jahr darauf schreibt FG dann jedoch: Der jährliche Eingang von der Milch macht 1000 Pesos aus, von den Hühnern nehmen wir 230 Pesos ein und etwas erwarte ich auch von den Kälbern, die ich gekauft habe. Für das kommende Jahr haben wir zum Schlachten dann einige Oechslein und 6-8 Schweine.
Immer und überall hat man auch seine Feinde. Das Jahr 1910 mit vier Briefen ist für Guntern ein schreibintensives; zweimal wendet er sich an den 16-jährigen Nepos (Neffe) Josef Carlen, zweimal an dessen Vater. (Josef Carlen übernimmt hin und wieder für seine Eltern die Korrespondenz.) Ich gehe auf die Briefe nur summarisch ein. Die schulmeisterliche Attitüde gegenüber dem Neffen wurde in der Einleitung bereits thematisiert.
Eine Textpassage aus dem Brief vom September sei hier noch zitiert. Es geht um die spanische Schreibweise seines Vornamens:
(…) Franz schreibt man spanisch Francisco, da ist nichts daran zu ändern. Man schreibt nicht François, nicht Francis, nicht Francesco, noch weniger Francesko. Den Laut k hat man in der spanischen Sprache nicht, bloss in einigen Fremdwörtern wird er gesetzt. Dessen Stelle vertritt im Spanischen c. Es wird auch wie k gesprochen ausser wenn ein i oder e darauf folgt wie in ciudad- cebo etc. Mein Lieber, nicht übel aufnehmen! Ihr mögt mir in allem andern überlegen sein, ich will Euch das nicht streitig machen, ich bin aber sicher, dass Ihr es in der spanischen Sprache nicht seid. Ich kann mit jedem Spanier verkehren, sei er hoch oder niedrig, und zwar schriftlich besser als mündlich, ohne jemanden nötig zu haben.
Ich schreibe fast so korrekt spanisch wie deutsch. Und dabei wollt ihr mir unter die Nase halten, ich könnte nicht meinen Namen schreiben! (…)
Wenige Sätze danach schlussfolgert er: Mein lieber Nepot! Damit hast du ein kleines Charakterbild von mir. Wenn es dir nicht gefällt, lasse davon ab. Ich nehme es dir nicht übel. Dass er damit nicht so recht in die Welt passe, habe er schon oft bitter erfahren müssen. Er habe sich deshalb soweit möglich von der Welt zurückgezogen. Auch wisse er zurzeit nicht, ob sie überhaupt auf diesem Land bleiben würden. Aufhorchen lässt die Aussage, dass auch die Söhne und Töchter ihre Feinde hätten*.*
Im Übrigen vermittelt der Brief durchaus passende Inhalte für den jungen Adressaten, insbesondere über die Schulbildung. Er rät Josef, mit dem Lernen keinesfalls aufzuhören, und rühmt ihn für die gut und stilgerecht verfassten Briefe. Solches könne er von seinen Söhnen (!) nicht erwarten; sie müssten leider eine argentinische Schule besuchen. Das nimmt er zum Anlass, die Einheimischen generell herabzusetzen: Argentinier seien vielleicht physisch gewandter als Europäer (v.a. im Umgang mit Pferden) und würden damit auch prahlen. In den Wissenschaften jedoch könnten sie nicht mithalten. – Das mag alles seine Berechtigung haben, aber angesichts von Gunterns Selbstbild erstaunt es nicht, dass er und seine Familie in der Aussenseiterrolle gefangen sind und dass zumindest er sich darin eingerichtet zu haben scheint. Womöglich erklärt das auch das permanente Bestreben, den Ackerbau auf grössere Flächen auszudehnen und beim Vieh nicht nur die Milchmenge zu steigern, sondern auch Einnahmen mit Schlachtvieh zu generieren, kurz, sich mittels Grösse von den Nachbarn abzuheben. Amüsiert zeigt er sich über seinen Herkunftsort, wo dem Neffen gemäss 17 Pferde und sechs Esel gezählt werden. Damit sei Reckingen wohl ritterlich geworden, spottet er, aber die Musik der Esel werde in den Gommer Bergen einen sonderbaren Widerhall auslösen.
Auf den ersten Blick rätselhaft erscheint die Anrede im Brief vom Juni: Liebwerter Nepos Josef Carlen, liebe Familie, liebe Gattin und Mutter! Weshalb Gattin und Mutter? Die Antwort geben die späteren im gleichen Jahr verfassten Briefe. Im Oktober schreibt Guntern, er habe zu einem bestimmten Termin die Rückkehr seiner Frau erwartet, sie sei aber nicht angekommen. Tatsächlich erfüllte sich früher als erwartet ihre 1897 geäusserte Hoffnung, in 15 Jahren einmal nach Hause zu kommen. Sie reiste 1910 ins Wallis und verbrachte einige Monate bei den Verwandten in Reckingen. (Gegen Ende Oktober traf sie wieder in Rafaela ein.) – Dass ihr Mann sie in der Anrede nennt, sich im Brief selbst aber einzig an den Neffen und mit keinem Wort an sie wendet, wirkt seltsam. Später erfährt man, dass er mit seiner Frau während ihrer Abwesenheit in regem Briefkontakt stand. Sie schrieb ihm dreimal, er ihr viermal. Allerdings kamen nur zwei seiner Briefe rechtzeitig an, der erste ging womöglich verloren, und als der letzte unterwegs war, befand sie sich auf der Rückreise. Die Hauptschwierigkeit ist, dass es in der Regel zwei Monate dauert, bis sie oder er Antwort erhält. Denn der Brief braucht einen Monat hin, die Antwort einen Monat zurück, so Guntern. – Zehn Tage, nachdem er in Rafaela vergeblich auf ihre Ankunft gewartet hat, schickt er seinen Ältesten hin*.* Im Brief erzählt er – sowohl rührend als auch eindrücklich realistisch:
So kam denn Franz mit der lieben Mutter fast unerwartet zuhause an. Denkt Euch, welch ein Jubel das bei der Familie war. Alle sprangen schreiend hinaus: „Die Mutter, die Mutter ist da!" Eine frohe, zufriedene Begrüssung wechselte allseits.
Glücklich und wohlerhalten ist Julia hier angelangt und wiegt sich zufrieden im Kreise ihrer lieben Familie. Gott sei Dank für die gütige Führung! Denn es ist wirklich keine Kleinigkeit für einen Vater oder eine Mutter, die noch kleine Kinder haben, eine solche Reise zu unternehmen. Wenn man bedenkt, wie viele Gefahren da drohend auftreten, muss man so etwas für gewagt halten. Aber Julia hatte eine so dringende Sehnsucht, einmal ihre lieben Geschwister wiederzusehen, dass ich ihr diesen Wunsch nicht versagen konnte. Und nun ist es glücklich vorbei, Gott sei Dank!
Vom Pachtbauern zum Grundbesitzer? (Brief vom 12.02.1912 aus Rafaela)
Die Fakten: Die Familie Guntern ist daran, nach Ceres, 160 km nordwestlich von Rafaela, umzuziehen. Dort hat FG für 15'300 Pesos 450 Hektaren Land gekauft8 und sich dabei mit 13'000 Pesos verschuldet. Der Transport der ganzen Bagage – dazu gehören der Maschinenpark, 50 Pferde und mindestens ebenso viel oder mehr Vieh – bringt die Familie an die Grenze der Belastbarkeit. Auch der 53-Jährige ächzt unter der der momentanen Situation. Nicht nur des physischen Aufwands wegen, sondern auch, weil sie ein schlechtes Erntejahr hinter sich haben und darum die Schuldenlast nicht wie erwartet verringern konnten. Sogar für einen Teil der ausstehenden Rechnungen, schreibt Guntern, fehle das Geld.
Der Brief ist aus dieser Anspannung heraus geschrieben. FG macht sich nicht nur Sorgen, sondern auch seinem Ärger Luft. Nicht gerade gut gelaunt ist er wegen dem Ältesten, dem 21-jährigen Franz. Was er dazu bemerkt, verrät die schwierige Beziehung zwischen den beiden. Anders ist nicht zu erklären, warum er ihn mitverantwortlich macht für die miese Ernte. (Sie hätten zu spät säen können, weil Franz exakt zu dieser Zeit krank geworden sei. Das sei der Hauptgrund für den Minderertrag.) Was ihn besonders ärgert, ist Franz' Heiratsabsicht. Davon hat er nicht von diesem selbst, sondern von Tochter Hedwig erfahren. An der jungen Frau hat er nichts auszusetzen, im Gegenteil, schreibt er doch: Ich weiss ja wohl, dass er seit 1½ Jahren Bekanntschaft hat mit der ältesten Tochter der Josette Walter von Selkingen9. Das Mädchen ist ein schönes, intelligentes, tätiges Mädchen von 22½ Jahren, nur zu gut für unsern Franz. Es dünkt einen, dass er dem Sohn das Potenzial abspricht, für Josette Walter der geeignete Lebenspartner zu werden. Auch der Folgesatz irritiert: Ich fürchte nur, dass sie vielleicht zu nobel ist für unsere Familie, wenn sie nicht etwas ablegt. Schwer zu verstehen, was er damit meint. Die Familie Walter (von deren Geschichte ich keine Kenntnis habe) ist zweifellos ebenfalls aus dem Wallis migriert. Dass Tochter Josette zu nobel für Gunterns Familie sein soll, ist nicht nachvollziehbar. Ausser wenn er damit seinen Sohn zum Bauernknecht herabsetzen will. Darin zeigt sich im Übrigen das Hauptproblem für die Kinder: Guntern kann dem Ziel, immer mehr Landwirtschaftsfläche zu bewirtschaften und endlich auch zu besitzen, nur näherkommen, wenn er sich selbst und die Kinder ausbeutet.10 – Dazu passen denn auch seine Pläne für 1912: Am neuen Ort soll ein gutes Stück Ackerland bestellt und die Melkerei fortgesetzt werden. Damit auch für die Weibsleute die Arbeit nicht fehle, will er sie die Milch verkäsen lassen. Voraussetzung sei, dass sie das Land bezahlen könnten. Hier blitzt einen Moment lang auch Genugtuung auf: Die Preise steigen ununterbrochen. Ich habe die 450 Hektar für 15300 Pesos gekauft; heute kosten sie schon 27000, und ich fühle gar nicht, dass ich um so viel reicher bin.
Bevor er zum Schluss kommt und den Angehörigen In Reckingen zum neuen Jahr Glück wünscht, folgt eine Bemerkung über ihre Kommunikationsform. Mit der Äusserung, er werde seinen Brief wohl als fades Geschwätz anschauen, hat der Schwager offensichtlich die kognitive Differenz zwischen ihnen angesprochen. Er scheint sich FG unterlegen zu fühlen. Gunterns Antwort:
Schreibe, wie Du willst, Deine Briefe werden mir immer lieb und teuer sein. Ich verlange ja nicht, dass Du mir poetische oder hochpolitische Phrasen schreibst. Wenn ich solche lesen will, so finde ich deren anderswo. In der Disposition, in der man sich befindet, denkt und fühlt man, und diese Gedanken und Gefühle bringt man eben zum Ausdruck, wenn man unverhohlen an jemanden schreibt. So geht es Dir, so geht es mir, so wird es auch vielen andern ergehen. Schreibe, wie Du willst, Deine Briefe werden mir immer lieb und teuer sein. Ich verlange ja nicht, dass Du mir poetische oder hochpolitische Phrasen schreibst. Wenn ich solche lesen will, so finde ich deren anderswo. In der Disposition, in der man sich befindet, denkt und fühlt man, und diese Gedanken und Gefühle bringt man eben zum Ausdruck, wenn man unverhohlen an jemanden schreibt. So geht es Dir, so geht es mir, so wird es auch vielen andern ergehen.
Der letzte Brief
Ceres, den 4. Februar 1914
Teurer Schwager, liebe Schwägerin und Familie!
Ich muss um Entschuldigung bitten, dass ich auf Deinen werten Brief nicht eher geschrieben habe. Julia war damals bei einer gut bekannten Familie in San Guillermo. Sie sollte um Neujahr zurückkommen, und dann wollte ich sie schreiben lassen, aber sie will sich nicht dazu verstehen. So muss ich denn wieder selber zur Feder greifen. Ihr schreibt, dass Ihr schon lange keine Nachricht von uns erhalten habt. Im verflossenen Winter (bei Euch Sommer) habe ich geschrieben und zugleich die Photographien geschickt von Theophil und Hedwig und von Franz und Maria. Habt Ihr dieselben nicht erhalten? Es freut uns, dass Ihr Euch alle gesund befunden habt; auch wir sind, Gott sei Dank, alle gesund. Das ist das Gute, so uns in diesen Jahren zuteil wurde. Darüber hinaus ist es in diesen Jahren nicht gut gegangen.
Ein Deutschrusse hat mich ordentlich beschwindelt, dass ich mein Leben lang dran denken werde. Dazu kamen noch zwei schlechte Jahre. Ich musste jenes Land in Argentina fahren lassen und habe nun noch 3500 Pesos Schulden dabei. Ich schreibe, wie es ist, frei und offen. Bei mittlerer Ernte können wir in zwei Jahren die Schulden tilgen, wenn nicht wieder schlechte Jahre eintreten. Wir werden dieses Jahr 200 Hektar ansäen, 100 mit Weizen und 100 mit Lein. Sodann will ich mit Viehzucht anfangen, wenn es möglich ist. Ich habe bereits angefangen, aber ich möchte den Viehstand noch vergrössern. Gegenwärtig besitzen wir 30 Stück Rindvieh, 47 Pferde, 12 Schweine, 10 Schafe etc. Für den Landwirt gibt es hier gegenwärtig kein besseres Geschäft als Viehzucht. Die Viehpreise sind noch im verflossenen Jahr um das Doppelte gestiegen, aber damit auch das Fleisch. Das macht der grosse Export. Wir kaufen vom Schlachter kein Fleisch mehr, wir schlachten für uns selbst, etwa drei Stück Rindvieh, vier bis fünf Stück Schweine und etliche Schafe im Jahr. Es ist auch schwer für Eltern, wenn die Kinder sich verheiraten, nachdem sie kaum den Kinderschuhen entwachsen sind; und dann sollte man ihnen noch helfen. Es ist in diesem Lande ein undankbares Geschäft, Kinder zu erziehen.
Für das bereits begonnene Jahr hätte ich nur einen Wunsch, dass Gott uns eine gute Ernte bescheren möchte, damit ich die Schulden bezahlen kann, und dann komme, was mag. Ich bin nun schon zu allem bereit. Leider muss ich noch einen Tanz mit dem Russen drehen.
Vor zwei Monaten erhielt ich einen Brief von Julia Walpen, geb. Eggs, dass sie einen Koffer von ihrer Tochter Emma11 an mich adressiert habe. Ich erhielt auch richtig die Anzeige von Buenos-Aires aus, dass sich für mich im Zollhaus ein Koffer vorfinde. Ich habe zweimal geschrieben, konnte ihn aber nicht herauskriegen, weil er als Ware eingeschrieben war. Ich hätte selbst hinfahren sollen und mich beim Zoll stellen. Das hätte mehr als 100 Fr. gekostet. So beschloss ich, abzuwarten, bis man weiss, wo jene Leute sich befinden, dass man ihnen den Frachtbrief zuschicken kann. Ich bitte daher, der Julia zu sagen, dass sie mir sobald wie möglich die Adresse von Emma oder besser von ihrem Manne übersende, damit ich ihnen die Sache zuweisen kann. Ich trage keine Schuld dar an. Es war etwas ungeschickt, ich kann nichts ändern.
Zum Schluss wünsche ich Euch viel Glück und Segen fürs bereits begonnene Jahr. Auch viele Grüsse an Franz, Eduard und Söhne. Gott möge uns alle zum Ziele führen, für das er uns erschaffen hat!
Es macht gegenwärtig sehr heiss. Das Thermometer schwankt zwischen 35 und 40° Celsius. Jedoch die Radikalen haben trotzdem noch nicht zu heiss; sie arbeiten fast wütend, um ans Ruder zu kommen, aber aller Aussicht nach wird es schweren Stand halten.12 Es gibt hier auch noch Männer, die bessere Weltanschauungen und Grundsätze haben, Gott sei Dank.
Nun will ich enden, ich könnte Euch sonst lästig werden. Man hat im Strudel des wirren Lebens oft Sachen im Kopf, die andere Menschen wenig interessieren. So empfanget denn tausend Grüsse von uns allen an Euch alle.
Euer Schwager
F'co Guntern
Wenn Guntern schreibt, er sei von einem Deutschrussen betrogen worden und habe deswegen jenes Land in Argentina fahren lassen müssen, meint er dann, die 450 ha Land in Ceres seien nicht mehr in ihrem Besitz? Dem widerspricht alles, was er sonst ausführt: Dass sie nach Ceres umgezogen sind, dort schon bald 200 ha Getreide ansäen werden – die Fläche entspricht der Grösse von 260 Fussballfeldern! – und die Viehwirtschaft ausbauen wollen. Oder sind sie auch am neuen Ort wiederum Pächter? Wenn dem so wäre, würde er das zweifelsohne mitteilen. Es ist deshalb anzunehmen, dass sie nach wie vor Besitzer eines Grossteils des erworbenen Landes sind. Wahrscheinlich haben sie von mehreren Verkäufern Boden erworben und sind dabei von einem, dem Deutschrussen, betrogen worden. Schon dies ist für Guntern eine Schmach; es einzugestehen fällt ihm wahrscheinlich schwer, aber er schreibt gleichwohl, wie es ist, frei und offen. Daneben vernimmt man auch diesmal von zwei schlechten Jahren sowie von Schulden in der Höhe von 3'500 Pesos. Wenn die bisherige Textdeutung richtig ist, belegt gerade diese Summe, dass sie finanziell vorangekommen sind, waren die Schulden doch zwei Jahre zuvor ums Vierfache höher. Schlechte Jahre sind dem ehrgeizigen Mann jene mit tieferen als den erhofften Erträgen.
Trotz der Demütigung, übers Ohr gehauen worden zu sein, besteht auch für die Familie Guntern Grund zum Optimismus. Die argentinischen Agrarexporte erreichen neue Höchstwerte. Neben Getreide wird zunehmend auch Rindfleisch exportiert. So schreibt FG von um das Doppelte gestiegenen Viehpreisen. Das wurde möglich, weil schon seit dem letzten Viertel des 19. Jahrhunderts im Land Kühlfabriken und Kühlschiffe gebaut werden, was die Ausfuhr von Fleisch nach Europa ermöglicht. Das macht Argentinien in der Zeit vor und während des Weltkriegs zu einem der weltweit reichsten Länder, und für Ackerbauern und Viehzüchter bedeutet das einen Aufschwung von nie geahntem Ausmass.
Im Widerspruch zu den Ausführungen erscheint folgende Formulierung: Und dann komme, was mag; ich bin nun schon zu allem bereit. Das tönt, als ob er kurz vor dem Bankrott stünde und nun alles auf eine Karte setzt, um auf Teufel komm raus dem Verhängnis zu entgehen. Viel eher dünkt mich, dass er die Chance packen will, sich als Grossbauer zu etablieren.
Leider sind von der Familie Guntern keine Fotografien mehr vorhanden, obwohl es solche gegeben hat. Hier lesen wir, er habe im letzten Brief zwei Fotos beigelegt, aber keine Reaktion darauf bekommen. Aufschlussreich sind die Sujets. Sie zeigten Theophil und Hedwig beziehungsweise Franz und Maria. Hedwig und Franz sind die zwei ältesten Nachkommen der Familie, während Theophil Hedwigs künftiger oder schon gegenwärtiger Ehepartner sein könnte. (Das Thema Heirat ist ja explizit angesprochen.) Theophil kann aber auch ein anderer Sohn sein. Das fünftgeborene Kind der Familie heisst Maria. Ob der inzwischen 23-jährige Franz und Maria auf dem Bild zu sehen waren, lässt sich nicht sagen. Franz als (evtl. künftigen) Ehepartner einer anderen Maria zu deuten, ist spekulativ, aber nicht auszuschliessen. (Die Auswahl von weiblichen und männlichen Vornamen ist zu dieser Zeit eher bescheiden.) Was aus Franz' früherer Absicht, sich mit Josette Walter zu verheiraten, geworden ist, bleibt offen.
Was es auch immer mit Heiratsabsichten auf sich hat, einzelne der Guntern-Kinder scheinen nicht gewillt zu sein, weiterhin als Arbeitskräfte beim Vater zu bleiben. Und da auch Julia Guntern nicht alle Wünsche ihres Mannes erfüllt, muss er für die Korrespondenz ins Wallis wieder selbst zur Feder greifen. Zudem wird ihm, wenn er als Ackerbauer und Viehzüchter wie erhofft reüssieren will, auch nichts anderes übrigbleiben, als das ganze Jahr über Landarbeiter zu beschäftigen.
Im Brief folgt der in der Einleitung zitierte Satz, kaum seien die Kinder erwachsen, verheirateten sie sich, und man müsse ihnen noch helfen. Dem lässt er ein eigenartiges Fazit folgen: Es ist in diesem Lande ein undankbares Geschäft, Kinder zu erziehen. Das klingt heute befremdlich, im damaligen Auswanderer-Kontext erstaunt die Aussage jedoch wenig.
Auch der am Briefende formulierte Kommentar über die politische Opposition passt ins Bild des ehrgeizigen Ex-Wallisers. Die argentinischen Radikalen fordern seit Jahren politische Veränderungen, weg von der Oligarchie, hin zu einer Form von Demokratie. Sie fordern insbesondere ein anderes Wahlrecht. Dem scheint Guntern wenig bis nichts abgewinnen zu können, ja, er spottet über die Radikalen. Auch jetzt noch, nachdem diese 1912 eine Wahlrechtsänderung durchgesetzt haben. (Im Jahr 1916 werden sie die bestehende Regierung ablösen.) Warum zeigt sich Guntern demokratiefeindlich? Dass er seinen penetranten Katholizismus mit der Ablehnung politischen Fortschritts verquickt, ist wohl der Walliser Herkunft geschuldet. Obwohl dies einem wie ihm an sich widersprechen müsste. Ihm, der auch darum ausgewandert ist, weil in Reckingen die Dorfmächtigen ihn am Vorankommen gehindert haben sollen. Gleichwohl ist es nachvollziehbar, glaubt er hier doch nun selbst an die Möglichkeit, bald zu den Wohlhabenden und damit politisch Einflussreichen zu gehören.
-
Für die eigentliche Geschichte wechsle ich ins grammatische Präsens. ↩︎
-
Dass er auch die Brüder nennt, ist eigenartig. Da er vor dem Wegzug auch deren Besitz versteigern liess, müssen sie eigentlich vor ihm in die USA emigriert sein. ↩︎
-
Von wem das Geld stammt, erfährt man nicht; die Adressaten wussten es zweifellos. ↩︎
-
Gemeint sind Rückentragkörbe, hier für Mist. ↩︎
-
«Kilozentner» = 100 kg; sie ernteten also 21,7 Tonnen Weizen. ↩︎
-
Luzerne wird oft als Königin der Futterpflanze bezeichnet. Sie ist auch auf trockenen Böden ohne Stickstoffdüngung ertragreich. Die Pflanze liefert viel Eiweiss und im Vergleich etwa mit der Sojabohne doppelt so viel Protein. ↩︎
-
Wie man sieht, gehen die Briefe nicht immer an die gleiche Familie; mit dem Schwager ist jeweils entweder der Ehemann von Gunterns Schwester oder (wie hier) Julias Bruder gemeint. ↩︎
-
Das entspricht einem Hektar-Preis von 68 Franken bzw. 68 Rappen für die Are oder 0,68 Rappen für den Quadratmeter. Das ist etwa halb so viel, wie in Rafaela zwei Jahre zuvor zu bezahlen war. ↩︎
-
Selkingen ist eine Gommer Gemeinde, 3 km südwestlich von Reckingen. ↩︎
-
Das zeigt schon die Auswanderer-Geschichte von Johann Christian Theler. Vor allem dessen Töchter wurden derart mit Arbeit be- bzw. überlastet, dass die meisten von ihnen die Familie verliessen. In der Folge musste Theler selbst aufgeben. ↩︎
-
Emma Warren, geborene Walpen, starb nach einem recht abenteuerlichen Leben 1946 in Reckingen. Sie entstammte der Glockengiesserfamilie Walpen. ↩︎
-
Bis 1912 war Argentinien keine Demokratie, sondern stand unter der Herrschaft der Oligarchen. Auf Drängen der Opposition wurde die Wahlpflicht eingeführt, was künftig den bisherigen Mechanismus des Wahlbetrugs stilllegte. Das machte es 1916 der Radikalen Bürgerunion möglich, die bisherige Regierung abzulösen. Ziel der neuen Regierung war eine Politik des nationalen Ausgleichs, u.a. die Aufnahme von Verhandlungen mit den Gewerkschaften. – Die Weltwirtschaftskrise liess die konservative Bewegung wieder erstarken, so dass es 1930 zum Militärputsch und dem Versuch kam, die alte Ordnung wiederherzustellen. Immerhin wurde das demokratische System beibehalten. (Quelle: Wikipedia) ↩︎
